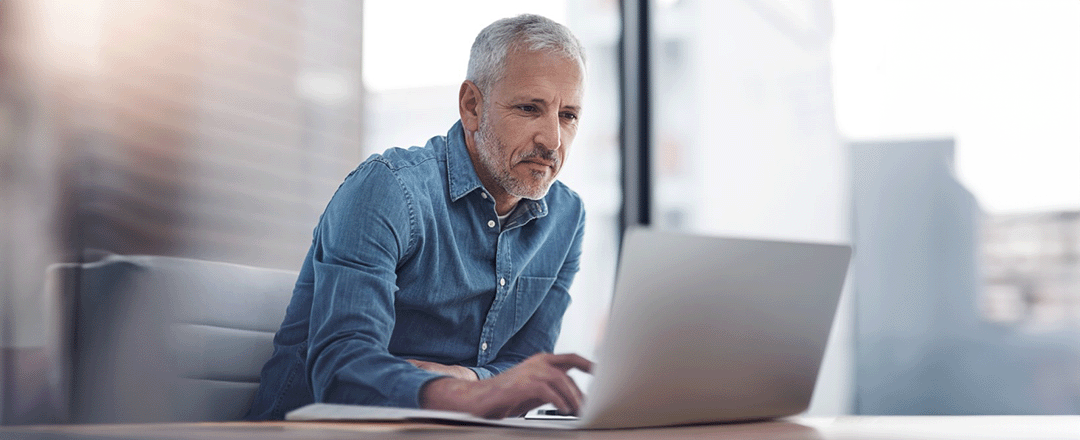AbbVie in der Ophthalmologie
AbbVie ist eines der führenden Unternehmen im Bereich der Augenheilkunde. Wir erforschen und entwickeln innovative Therapieoptionen und profitieren dabei von mehr als 70 Jahren Expertise durch Allergan in diesem Bereich. Das Portfolio von AbbVie umfasst Therapien für die weltweit häufigsten Augenerkrankungen, darunter Glaukom und Netzhauterkrankungen wie das diabetische Makulaödem, das retinale venenverschlussbedingte Makulaödem und Uveitis.
Glaukom und Netzhauterkrankungen - AbbVie als starker Partner an Ihrer Seite
Mit zielgerichteter Forschung, wegweisenden Initiativen und in Zusammenarbeit mit starken Partner*innen tragen wir zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung bei. Dabei geht unser Selbstverständnis über die Erforschung und Bereitstellung von Medikamenten hinaus. In der Augenheilkunde setzen wir den Fokus auf Glaukom und Netzhauterkrankungen – darunter DMÖ, RVV und Uveitis.
Erfahren Sie hier mehr über die neusten Erkenntnisse aus der Forschung, Erfahrungen unserer Fachexpert*innen sowie Highlights aus unseren Fortbildungsveranstaltungen.
Unsere empfohlenen Artikel & Events
Sehen Sie sich diese Artikel an, die für Sie von Interesse sein könnten.
Wähle einen Filter aus:
Angewendete Filter:
Thema
Entschuldigung, wir konnten keine Artikel finden, die mit deiner Auswahl übereinstimmen.
Filter zurücksetzen , um wieder alle verfügbaren Artikel zu sehen
Unsere Produkte in der Ophthalmologie
Sie suchen nach detaillierten Informationen für Patient*innen?
Unser Service für Sie
Übersicht über ophthalmologische Erkrankungen
Das Glaukom (auch als Grüner Star bekannt) ist eine chronische Augenerkrankung, bei der in ihrem meist langsamen Verlauf der Sehnerv auf irreversible Weise geschädigt wird. Unbemerkt und unbehandelt kann es so zur Erblindung kommen.1
Die Ursache kann z.B. in einer Dysbalance des Kammerwassers liegen, welche zu einem langanhaltenden erhöhten Augeninnendruck führt und dieser wiederum verantwortlich für eine geschwächte Durchblutung der empfindlichen Sehnervenfasern wird. 2
Durch die daraus resultierende Nervenschädigung kann auf Dauer ein Ausfall des Gesichtsfelds auftreten, jedoch wird dieser zunehmende Sehverlust von den Betroffenen meist erst im fortgeschrittenen Stadium bemerkt. Umso wichtiger sind regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen ab 40 Jahren, die bei einer frühen Diagnose die Erkrankung gut therapierbar machen. 3
Beim Großteil der etablierten Therapien kann durch eine Senkung des Augeninnendrucks der Sehnerv entlastet werden. Eine regelmäßige Kontrolle ist jedoch unabdingbar, um die Therapie entsprechend anzupassen. 4
Quellen:
- https://www.nei.nih.gov/learn-about-eye-health/eye-conditions-and-diseases/glaucoma#:~:text=What%20is%20glaucoma%3F,a%20comprehensive%20dilated%20eye%20exam. Letzter Abruf: April 2024.
- https://www.nei.nih.gov/learn-about-eye-health/eye-conditions-and-diseases/glaucoma/glaucoma-and-eye-pressure Letzter Abruf: April 2024.
- http://www.glaukom.de/glaukom-wissen-und-vorbeugen/ Letzter Abruf: April 2024.
- https://www.uniklinikum-dresden.de/de/das-klinikum/kliniken-polikliniken-institute/augenheilkunde/informationen-fuer-patienten/wichtige-augenerkrankungen Letzter Abruf: April 2024.
Diabetisches Makulaödem (DMÖ) & retinaler Venenverschluss (RVV)
Das Makulaödem ist eine Augenerkrankung im Bereich des schärfsten Sehens auf der Netzhaut, welche zu Sehstörungen und fortschreitender Sehverschlechterung bis hin zur Erblindung führen kann.1 Es gibt verschiedene ursachendifferenzierte Formen, unter anderem das diabetische Makulaödem (DMÖ) als Folge von Diabetes und das Makulaödem, welches in Folge von retinalen Venenverschlüssen (RVV) auftritt.
Bei beiden oben genannten Formen tritt, bedingt durch Schäden an den Blutgefäßen im Auge, Flüssigkeit in die Netzhaut aus, was bei einer augenärztlichen Untersuchung als Verdickung und Ansammlung von Ablagerungen erkennbar ist. Um ein Fortschreiten der Erkrankung zu verhindern, sind Früherkennung und frühzeitige Therapie sehr wichtig.1,2,3
Während zunächst Farben oder Kontraste nicht mehr ganz so gut zu erkennen sind, treten schwerwiegendere Sehstörungen erst auf, wenn die Makula direkt betroffen ist: Probleme beim Lesen und verschwommenes sowie verzerrtes Sehen beeinträchtigt dann zunehmend den Alltag und die Lebensqualität.3,6
Für eine erfolgreiche Therapie ist grundsätzlich eine gute Einstellung der Blutzuckerwerte wichtig, was ein Fortschreiten der Erkrankung verhindern oder zumindest verzögern kann.4,5 Ziel einer Therapie sollte es sein, die Krankheit, soweit möglich, nicht nur aufzuhalten, sondern die Ursachen zu bekämpfen und die Sehkraft zu verbessern. Es ist also wichtig, dass Ihr Arzt Ihre gesamte Krankheitsgeschichte kennt. Je früher die Behandlung beginnt, desto besser sind Ihre Chancen für gute Ergebnisse.5
Und so ist es nicht nur das Ziel, Ihr Sehvermögen zu erhalten oder sogar zu verbessern, sondern auch weitere Komplikationen wie Grüner Star oder Netzhautablösungen zu verhindern. 6
Uveitis
Eine nicht infektiöse Uveitis ist eine Entzündung der mittleren Augenhaut, der Uvea, welche nicht auf eine Infektion durch Bakterien, Viren oder Pilze zurückzuführen ist.7
Eine Uveitis kann das gesamte Auge betreffen oder auf die Regenbogenhaut im vorderen Teil des Auges begrenzt sein.
Bei einer Entzündung des hinteren Augensegments sind die Aderhaut und die Netzhaut betroffen. Anders als bei einer Uveitis im vorderen Bereich, ist das Auge hier nicht gerötet. Da diese Form der Uveitis in der Regel nicht schmerzhaft ist, nehmen Betroffene ihre Erkrankung häufig erst wahr, wenn Sehprobleme auftreten. 7 So wird berichtet, dass sie eine Art Schwebeteilchen wie unregelmäßig schwebende schwarze Punkte oder dünne Linien sehen, oder dass sie verschwommen sehen und ihr Sehvermögen vermindert ist.8
Meist entwickelt sich die Entzündung der mittleren Augenhaut im Rahmen einer den ganzen Körper betreffenden, nicht-infektiösen Systemerkrankung. Hierbei spricht man von Autoimmun-Prozessen, bei denen das Immunsystem sich aufgrund einer Fehlsteuerung gegen körpereigene Strukturen wendet.7
Somit kann eine nicht infektiöse Uveitis einerseits Folge einer bereits bekannten Grunderkrankung sein, andererseits aber auch das erste Anzeichen dafür sein. Deshalb schließen sich der augenärztlichen Behandlung häufig weitere Untersuchungen bei einem entsprechenden Fachärzt*innen an. Bei bis zu der Hälfte aller betroffenen Patient*innen jedoch kann der/die Behandler*in das Entstehen einer Uveitis nicht erklären, da diese spontan oder aus unbekannten Gründen auftritt.7
Quellen:
- https://www.netdoktor.de/krankheiten/makulaoedem/, letzter Zugriff April 2024
- https://flexikon.doccheck.com/de/Retinaler_Venenverschluss, letzter Zugriff April 2024
- https://www.diabinfo.de/leben/folgeerkrankungen/augen.html, letzter Zugriff April 2024
- Deutsches Ärzteblatt 2010; 107(5): 75–84 DOI: 10.3238/arztebl.2010.0075 https://www.aerzteblatt.de/archiv/67564/Diabetische-Retinopathie, letzter Zugriff April 2024
- https://www.leitlinien.de/themen/diabetes/archiv/pdf/diabetes-netzhautkomplikationen/dm-netzhautkomplikationen-2aufl-vers2-lang.pdf, letzter Zugriff April 2024
- https://www.noviavital.de/project/gesundheitsinformationen-krankheitsbilder-retinaler-venenverschluss-rvv/, letzter Zugriff April 2024
- https://www.netdoktor.de/krankheiten/uveitis/, letzter Zugriff April 2024
- https://flexikon.doccheck.com/de/Uveitis, letzter Zugriff April 2024